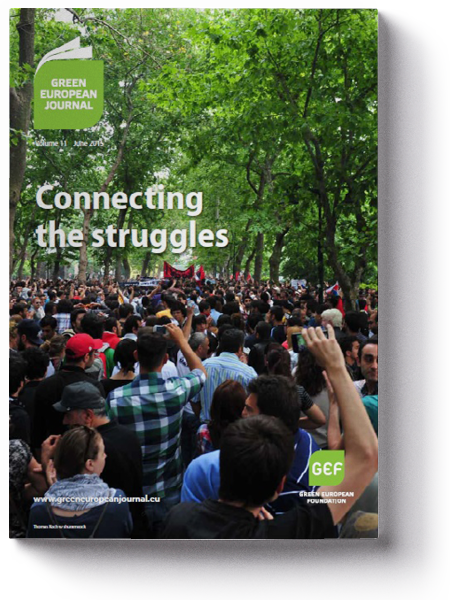„Bisher ist es auch uns Grünen und den Umweltbewegungen nicht gelungen, dass in Europa die wirtschaftliche, die ökologische und die soziale Krise zusammen behandelt werden” – meint der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Gerhard Schick. Wir unterhielten uns über sein Buch „Machtwirtschaft – Nein danke!”
Was sind Ihrer Meinung nach die offensichtlichsten Symptome, an denen man erkennen kann, dass irgendetwas in der heutigen Wirtschaft schief läuft?
Da ist zum einen die Finanzkrise, die nach wie vor in einer hohen Arbeitslosigkeit zum Ausdruck kommt. Aber es hat sich auch strukturell etwas geändert: die Marktwirtschaft, wie sie eigentlich gedacht war, funktioniert nicht mehr. Das hat zum Einen damit zu tun, dass einige Unternehmen eine sehr starke Macht bekommen haben, und dadurch die Konditionen diktieren können, zweitens hat es aber auch damit zu tun, dass die Finanzmärkte nach wie vor eine viel zu starke Rolle spielen, und deshalb die Bedingungen auf den Märkten stark beeinflussen. Und der dritte Grund, der mit den ersten beiden zusammenhängt, ist Folgender: die Unternehmensinteressen dominieren ganz häufig die Politik. Der Staat setzt, anders als das in einer Marktwirtschaft gedacht ist, häufig nicht mehr die Regeln, , sondern die großen Unternehmen versuchen, die Regeln selber zu setzen. Diese drei Phänomene zusammen nenne ich Machtwirtschaft, weil nicht faire Märkte unsere Wirtschaft dominieren, sondern große Kapitalgesellschaften.
In Ihrem Buch erwähnen Sie, dass Sie in Hongkong die Gelegenheit hatten, mit geschädigten KleinanlegerInnen – die vor der Bankenaufsichtsbehörde demonstriert hatten – zu sprechen. Was haben Sie bei dieser Begegnung erfahren?
Das Spannende war zu sehen, dass das Problem des AnlegerInnenschutzes auch hier dasselbe war wie in Europa: die Großbanken hatten unerfahrenen KundInnen die Risiken aufgedrückt. Das hat in Hongkong genauso stattgefunden wie in Deutschland. Und man sieht, dass die großen Unternehmen die Schwächen der verschiedenen Standorte gezielt ausnutzen können, und die VerbraucherInnen zum Spielball werden. Das ist nicht gut so: Man müsste Märkte eigentlich so organisieren, dass es gut für die KundInnen ist.
Das ist ein Thema, das seit der Pleite von Lehman Brothers schon allen bekannt sein müsste. Deshalb stellt sich auch die Frage: Warum geht es in der Wirtschaft nach der Krise fast genauso weiter, wie vorher?
Viele Sachen haben sich in den letzten Jahren geändert: Wir haben wahnsinnig viele Gesetze verabschiedet, sowohl auf der nationalen, wie auch auf der europäischen Ebene. Aber die entscheidende Veränderung hat deshalb nicht stattgefunden, weil die Machtverhältnisse immer noch falsch sind. Die Finanzmärkte wachsen weiter, die Ungleichgewichte sind immer noch da. Es ist immer noch so, dass der Staat in vielen Fällen gar nicht in der Lage ist, wirklich zu kapieren, was an den Märkten stattfindet. Die gesetzlichen Regelungen können häufig auch nicht durchgesetzt werden. Das ist entweder so, weil die staatlichen Aufsichtsbehörden viel zu schwach sind, oder weil gar nicht der politische Wille da ist, diese Regelungen durchzusetzen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass in vielen Fällen die Gesetze zwar bestehen, dass die Behörden aber letztendlich ohne die Informationen aus den Unternehmen gar keine Chance habenzu verstehen, was die Banken machen, und deshalb viele Probleme nicht rechtzeitig wahrgenommen werden.
Sie schreiben aber auch, dass Großbanken immer noch Subventionen in Milliardenhöhe von den SteuerzahlerInnen bekommen. Das zeigt eigentlich nicht den Willen, dass der Staat etwas mit dieser Übermacht anfangen wolle.
Es hat schon eine Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften gegeben, deswegen kann man nicht sagen, dass nichts geschehen ist. Doch nach wie vor haben große Unternehmen häufig Sondervorteile, nicht nur die Großbanken. Etwa im steuerlichen Bereich, wo die großen Unternehmen in der Europäischen Union die Staaten gegeneinander ausspielen. Letztlich müssen kleine Unternehmen und ArbeitnehmerInnen ihre Steuern zahlen, aber große Unternehmen ihre Erträge nur gering besteuern. Das ist ein Vorteil, den kleine Unternehmen nie aufholen können, egal, wie gut sie sind. Und das beeinflusst natürlich den Wettbewerb.
Der Staat hat, als Regulierer, in den letzten Jahren, oder Jahrzehnten viel an Legitimität verloren, da er nichts mit den Problemen anfangen konnte. Was kann oder sollte der Staat jetzt in dieser Situation tun?
Es ist sehr wichtig, auch die Defizite im Staat anzugehen. Die großen Parteien wollensie häufig nur vertuschen. Wir haben das in sehr vielen Staaten gesehen Auch Deutschland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, denn auch dort musste kaum einE PolitikerIn die Konsequenzen der Fehler tragen, die zur Bankenkrise geführt haben. Und da wollen die Leute dem Staat, der so viel falsch gemacht, natürlich hat nicht vertrauen. Ich glaube, dass gerade die Grünen, mit ihrer eher staatsskeptischen Haltung eine gute Antwort geben können, indem sie sagen „Wir brauchen harte und einfache Regeln” anstatt das Ganze der staatlichen Bürokratie zu überlassen. Auch staatliche Banken brauchen ein sehr gutes Controlling, weil sie sonst genauso Mist machen können wie die privaten Banken. In Europa gab es eine Menge erschreckender Beispiele, dass die staatlichen Institute nicht besser waren als die privaten.
Oft sehen wir auch, dass die KundInnen in diesem Spiel der Großkonzerne mitspielen. Wir wissen, dass viele Produkte uns schaden, dennoch kaufen wir sie. Warum?
Häufig haben wir keine guten Informationen. Manchmal wissen wir es, aber dann ist es schwierig zu wechseln. Ich finde, es ist sehr gut, wenn Leute beim Konsum darauf achten, gute Produkte zu kaufen. Es ist auch wichtig, gute Anbieter zu unterstützen, aber das wirklich Wichtige erreichen wir nur politisch, durch eine Änderung der Regeln. Wir müssen dafür sorgen, dass die VerbraucherInnen auf Augenhöhe mit den Unternehmen sind, damit sie sich auch wehren können. Wir müssen die Regeln so setzen, dass intransparente Finanzprodukte auch einfach aus dem Verkehr gezogen werden können, und dass die Haftung bei schädlichen Produkten verbessert wird, so dass die Unternehmen Angst davor haben, schlechte Produkte überhaupt auf den Markt zu bringen. Ich finde, man sollte nicht allein den einzelnen VerbraucherInnen die Verantwortung in die Schuhe schieben.
Sie schreiben auch über die Gesellschaftsverantwortung (CSR – Corporate Social Responsibility) der Großfirmen, und meinen, dass diese Aktivitäten meistens nur der Imageförderung und dem Marketing dienen.
Da gibt es natürlich in einigen Bereichen positive Beispiele, aber insgesammt ist es so, dass die Kapitalgesellschaften das Ziel haben, das Vermögen der AktionärInnen zu mehren. Alle ökologischen und sozialen Aspekte sind dem untergeordnet. Deshalb sage ich, dass wir die DNA, also die Grundstruktur, der Unternehmen ändern müssen, wenn wir nicht wollen, dass es in unser Wirtschaft nur um Finanzen und Geld geht. Sonst geht die Wirtschaft an unseren Bedürfnissen vorbei, denn den Menschen geht es nicht nur um Geld. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Berichterstattung der Unternehmen so ausgestalten, dass sie auch soziale und ökologische Fragen öffentlich machen müssen.
Aber wie können wir die DNA dieser Firmen verändern?
Neben den Berichtpflichten sollten wir das Aktienrecht verändern, sodass es möglich ist, soziale und ökologische Zielgrößen in den Zielhorizont einer Unternehmung zu integrieren. Hier komme ich auch auf die Frage der Machtwirtschaft zurück: man soll dafür sorgen, dass die Unternehmen uns nicht über den Kopf wachsen. Wir stellen ja fest, dass es sehr viele, kleine, eigentümergeführte Unternehmen gibt, die sehr wohl Verantwortung in ihrer Community übernehmen, wo der Chef nicht um jeden Preis Gewinn machen will, wo es auch wichtig ist, dass man mit den MitarbeiterInnen anständig umgeht, und die Umwelt nicht unnötig belastet wird. Wenn die großen Firmen das alles platt machen, dann bleibt natürlich nur wenig Raum dafür. Das ist auch, warum ich mich als Grüner mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäftige: Wenn wir wollen, dass das Klima geschützt wird, wenn wir wirklich Artenschutz betreiben möchten, wenn wir wollen, dass ethische Aspekte nicht untergehen, dann müssen wir uns kritisch mit den mächtigen, großen AkteurInnen, denen es nur um die Rendite geht, auseinandersetzen. Wenn wir das nicht machen, dann haben grüne Ziele wie der Klimaschutz keine Chance.
Haben Sie nicht das Gefühl, dass mit der Krise die Frage vom Klima ganz beiseite geschoben wurde? Anscheinend fokussiert man nur noch auf finanzielle und ökonomische Lösungen zu den Problemen der Wirtschaft.
Bisher ist es auch uns Grünen und den Umweltbewegungen nicht gelungen, dass in Europa die wirtschaftliche, die ökologische und die soziale Krise zusammen behandelt werden. Es wurden ja nicht nur unsinnige Immobilienprojekte gebaut, die finanziell eine Katastrophe sind, sondern ganz viele Menschen haben auch ihre Häuser und ihr Einkommen verloren, wegen der hohen Verschuldung. Daneben wurden auch total viele Ressourcen verschwendet auf wirtschaftliche Projekte, die niemand braucht, obwohl wir auch wirkliche Probleme haben, mit denen man sich auseinandersetzen müsste. Das ist gerade das, was wir mit dem Green New Deal meinen: Wir müssen versuchen, in dieser Krise die Wirtschaft neu aufzustellen, denn die Wirtschaftsweise der letzten Jahre hat nicht nur ökonomischen, sondern auch sozialen und ökologischen Schaden angerichtet.
Aber die Grünen sind nicht unter den größten Parteien in Europa; sie waren nur wenige Male Teil einer Regierung. Wie können sie dann erreichen, dass auch andere Parteien das Thema des Green New Deal aufgreifen?
Ich denke, dass wir als Grüne in den letzten Jahren den Fehler gemacht haben, dass wir die drei Dimensionen nicht konsequent genug zusammengedacht haben, und uns sehr stark auf die ökonomische Logik allein eingelassen haben. Das steht natürlich in der Krise im Vordergrund, aber wenn wir uns nur auf das Ökologische fokussieren, dann sind wir nicht nah genug an den aktuellen Sorgen der Menschen dran. Wir müssen also die drei Dimensionen zusammen behandeln, und dann weitere Akteure überzeugen, die ebenfalls unsere Wirtschaftsweise verändern wollen.
Am Ende ihres Buchs plädieren sie für einen anderen Politikstil. Wie sollte diese „Politik des Gehörtwerdens” aussehen?
Das ist meine Konsequenz daraus, dass ich sehe, dass der Staat und die Politik in vielen Fällen die Probleme nicht lösen kann, ja Teil des Problems war und ist. Als PolitikerIn sollte man mit dem Versprechen „Wir machen jetzt alles besser!” sehr vorsichtig umgehen. Ohne die Unterstützung aus der Bevölkerung wird es uns kaum gelingen, gegen die vorherrschenden Machtstrukturen eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik zu erreichen. Ein gutes Beispiel ist doch TTIP oder die Finanztransaktionsteuer, wo grüne ParlamentarierInnen gute Arbeit gemacht haben, aber jeweils erst die Unterschriften von vielen Tausenden BürgerInnen den nötigen Druck aufgebaut haben, um die politische Debatte zu verändern. Ich denke, es hilft allen Ländern, wenn BürgerInnen sich gesellschaftlich engagieren, und politische Fragen nicht nur den BerufspolitikerInnen überlassen. Und umgekehrt: Auch die Politik darf zivilgesellschaftliche Akteurinnen nicht ausgrenzen.
Viele Leute fühlen, dass diese Wirtschaft nicht für sie da ist, und ich glaube, die grundlegenden Antworten können nicht nur von Oben kommen. Da müssen sich die Menschen aktiv einmischen.
Die Wirtschaftskritik der DemonstrantInnen von Blockupy ist an vielen Punkten ähnlich wie Ihre Vorderungen. Was denken sie von den – manchmal auch gewalttätigen – Mobilisationen von Blockupy?
So richtig manche Forderungen waren, die in Frankfurt geäußert wurden: Diese Art von gewaltätigem Protest, wie er in Frankfurt stattgefunden hat, lehne ich ab, und da sind wir uns in der Partei ganz einig. Ich finde auch, dass die Idee, die Kritik an die Europäische Zentralbank zu richten, nicht gut war. Ich denke, das war die falsche Addresse, denn die EZB tut im Moment relativ viel um die Krise zu bekämpfen. Sie hat zwar auch viele Fehler gemacht, zum Beispiel in den Verhandlungen mit den Krisenländern, als Teil der Troika. Aber die wahren Probleme liegen dennoch in Berlin und den anderen europäischen Regierungssitzen, wo die Austeritätspolitik durchgesetzt wurde und die nötige Neuausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik auf Investitionen und einen Abbau der Arbeitslosigkeit blockiert wird. Dagegen sollten wir protestieren.
Über Blockupy ist meine Einschätzung auch, dass das eine relativ enge Gruppe ist, die es nicht geschafft hat die breiteren Schichten der BürgerInnen mitzunehmen. Ich glaube, wenn wir wirklich etwas erreichen möchten, müssen wir viel mehr Leute mitnehmen, und die Gewalttätigen ausgrenzen.
Warum gibt es im Norden Europas zurzeit keine so großen Massenproteste, wie die der Indignados in Spanien oder Occupy Wall Street in New York?
Im Moment profitieren Deutschland und ein paar andere nördliche Länder von der Krise. Die Arbeitslosigkeit sinkt bei uns, die Löhne steigen, weil der Eurokurs zu niedrig ist für die Situation der deutschen Wirtschaft und die Zinsen auch. So profitierte der Bundeshaushalt seit dem Ausbruch der Krise mit 94 Milliarden Euro geringerem Schuldendienst.. Anders als in anderen EU Mitgliedstaaten, wo jetzt gekürzt wird, konnte der Staat hier mehr Geld ausgeben. Die meisten Deutschen merken also die dramatischen Auswirkungen der europäischen Krise nicht und spüren keinen Grund gegen die falsche Krisenpolitik zu protestieren. Dabei ist die Politik, die gerade gemacht wird, sehr kurzfristig orientiert, und langfristig auch für Deutschland schädlich, denn uns kann es nur gut gehen, wenn es unseren europäischen Partnerländern auch gut geht.